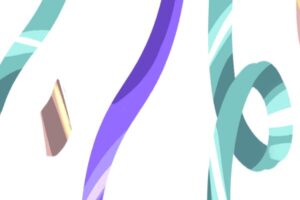Bergweihnacht 2025 auf dem Schaumbergplateau
6. November 2025
Offener Brief von Bürgermeister Andreas Maldener an Arbeitsminister Magnus Jung zur heutigen Plenardebatte
12. November 2025Abrechnung der Sanierungsgebiete in der Gemeinde Tholey Fragen und Antworten bei der Infoveranstaltung in der Kulturhalle Hasborn

„Wie kommt der Bodenwert zustande?“, Warum endet das Sanierungsgebiet direkt bei meinem Nachbarn?“ und „Warum muss ich zahlen, auch wenn bei mir keine Maßnahme durchgeführt wurde“. Diese und viele weitere Fragen wurden am vergangenen Montag in der Infoveranstaltung zur „Abrechnung von Sanierungsgebieten in der Gemeinde Tholey“ gestellt, die die Gemeinde Tholey aus aktuellem Anlass für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger aus den Ortsteilen Hasborn-Dautweiler und Tholey angeboten hatte.
Bürgermeister Andreas Maldener gab zu Beginn eine ausführliche Einleitung mit den wichtigsten Hintergrundfakten, die letztendlich dazu geführt hatten, dass die Gemeindeverwaltung sich dazu entschlossen hat, transparent in einen Bürgerdialog zu treten und den Sachverhalt für alle Betroffenen greifbar und erklärbar zu machen. Gemeinsam mit den Mitarbeitern aus dem Fachbereich Bauen, Umwelt, Wohnen der Gemeinde Tholey, Christian Henkes und Ina Klein, sowie mit Dr. Unbehau, der die Gutachten zur Abrechnung der Sanierungsgebiete in Tholey und Hasborn-Dautweiler erstellt hatte, kam es zu einem regen Austausch zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und der Verwaltungsspitze der Gemeinde Tholey.
Dabei gab der Gutachter zunächst grundlegende Einblicke in die Erarbeitung aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zum vorgelegten Gutachten.
Bürgermeister Andreas Maldener, der die Betroffenen in der prall gefüllten Hasborner Kulturhalle mit den wichtigsten Informationen versorgte, hat im nachfolgenden, ausführlichen Statement die wichtigsten Fragen und die relevanten Antworten in einem Infotext zusammengefasst:
Häufig gestellte Fragen und Antworten zur Abrechnung von Sanierungsgebieten in der Gemeinde Tholey
Was sind Sanierungsgebiete und wozu diesen sie?
Viele Gemeinden im Saarland – darunter auch die Gemeinde Tholey – haben Ende der 80er Jahre die Einrichtung von förmlichen Sanierungsgebieten beschlossen. Wenn eine Gemeinde ein solches förmliches Sanierungsgebiet festlegt, sollen in diesem Bereich städtebauliche Missstände beseitigt und die Lebens- und Wohnqualität verbessert werden. Die Grundlagen hierfür befinden sich im Baugesetzbuch (BauGB).
Welche Maßnahmen wurden in den Sanierungsgebieten zur Erreichung dieser Ziele umgesetzt?
Im Verlaufe der Sanierungsmaßnahmen über die vergangenen Jahrzehnte hinweg wurden in Hasborn-Dautweiler und Tholey wesentliche Zielsetzungen der Sanierung erreicht. Zur Verbesserung und Attraktivierung des öffentlichen Raumes wurden durch die Gemeinde Tholey u.a. die folgenden städtebaulichen Maßnahmen durchgeführt.
Allgemein:
- Ankauf→ und Abbruch verschiedener Grundstücke und Gebäude als vorbereitende Maßnahmen.
- Sanierung→ und teilweise Neuordnung der technischen Infrastruktur (z. B. Wasser-, Abwasser- und Stromleitungen,
- Aufwertung→ öffentlicher Grün- und Freiflächen,
In Tholey (u.A.):
- Neugestaltung→ der Ortsmitte und des Festplatzes,
- Modernisierung→ und Instandsetzung öffentlicher Gebäude (Rathaus und Turnhalle) sowie des Abtgebäudes in Tholey.
In Hasborn-Dautweiler (u.A.):
- Modernisierung→ und Instandsetzung des alten Rathauses sowie der Turnhalle,
- Neugestaltung→ des Marktplatzes und Neugestaltung des Brühlparks und des Schulumfeldes.
- →
Was sind die Auswirkungen eines Sanierungsgebiets auf die Grundstücke im betreffenden Gebiet?
Kurz gesagt: Sanierungsgebiete führen zu Bodenwertsteigerungen, weil die durchgeführten städtebaulichen Verbesserungen die Lagequalität, Nutzbarkeit und Attraktivität der Grundstücke erhöhen – was sich in steigenden Bodenpreisen niederschlägt.
Der Bodenwert ist der Marktwert des Grundstücks ohne Bebauung. Dieser hängt im Wesentlichen von der Lagequalität, der Nutzbarkeit und den Erwartungen an zukünftige Entwicklungen ab. Durch Sanierungsmaßnahmen verbessert sich diese Lagequalität – teils erheblich. Im Einzelnen:
- a)→ Verbesserte städtebauliche und infrastrukturelle Qualität
- Straßen→, Plätze und Grünanlagen werden neugestaltet.
- Verkehrsanbindung→, Erschließung und Versorgungsinfrastruktur (z. B. Wasser, Strom, Internet) werden modernisiert.
- b)→ Steigende Nachfrage nach Grundstücken
- Eine→ attraktivere Umgebung zieht mehr Investoren, Unternehmen und Bewohner an.
- Höhere→ Nachfrage bedeutet steigende Bodenpreise.
- c)→ Erwartungen an zukünftige Entwicklung
- Schon→ die Ankündigung eines Sanierungsgebiets signalisiert: „Hier passiert etwas – das Gebiet wird aufgewertet.“
- Diese→ Erwartung zukünftiger Wertsteigerung führt häufig schon im Vorfeld zu höheren Bodenrichtwerten.
- d)→ Rechtliche und planungsrechtliche Aufwertung
- Im→ Zuge der Sanierung werden oft neue Bebauungspläne aufgestellt oder Nutzungsmöglichkeiten erweitert.
- Wenn→ z. B. höhere Geschossflächenzahlen oder eine Mischnutzung (Wohnen + Gewerbe) erlaubt werden, steigt der potenzielle Ertrag des Grundstücks – und damit sein Bodenwert.
Was bedeutet Abrechnung des Sanierungsgebiets und wie geht das?
 Nach den §§ 154 ff. BauGB ist die Gemeinde gesetzlich verpflichtet, nach Abschluss der Sanierung das Verfahren abzurechnen. Dabei wird ermittelt, in welchem Umfang die Grundstücke im Sanierungsgebiet durch die städtebaulichen Maßnahmen an Wert gewonnen haben. Die Abrechnung dient also dazu,
Nach den §§ 154 ff. BauGB ist die Gemeinde gesetzlich verpflichtet, nach Abschluss der Sanierung das Verfahren abzurechnen. Dabei wird ermittelt, in welchem Umfang die Grundstücke im Sanierungsgebiet durch die städtebaulichen Maßnahmen an Wert gewonnen haben. Die Abrechnung dient also dazu,
- den→ Erfolg der Sanierung nachvollziehbar zu dokumentieren,
- eine→ faire Kostenverteilung zwischen der Allgemeinheit (Steuermitteln) und den privaten Eigentümerinnen und Eigentümern sicherzustellen und
- das→ Sanierungsverfahren ordnungsgemäß abzuschließen.
Der Ausgleichsbetrag ist dabei kein willkürlicher Beitrag, sondern beruht auf einer sachgerechten Bewertung. Für jedes Grundstück wird der Bodenwert vor Beginn der Sanierung (sogenannter Anfangswert) und der Bodenwert nach Abschluss der Sanierung (Endwert) festgestellt.
Die Differenz zwischen diesen beiden Werten ist die sanierungsbedingte Bodenwertsteigerung – also der Wertzuwachs, der sich durch die öffentlichen Maßnahmen ergeben hat. Der zu zahlende Ausgleichsbetrag orientiert sich letztlich an dieser Wertsteigerung. Er soll den Anteil des Grundstückseigentümers an der durch öffentliche Mittel ermöglichten Aufwertung widerspiegeln. Die konkrete Höhe wird nach einheitlichen Bewertungsverfahren berechnet und in einem Bescheid festgesetzt. Diese Ausgleichsbeträge belaufen sich in den betroffenen Fällen in Hasborn-Dautweiler und Tholey auf wenige Euro bis hin zu mehreren tausend Euro pro betroffenes Grundstück.
Wer hat den Bodenwert und die Bodenwertsteigerung ermittelt?
Die Berechnungen wurden von einem unabhängigen Gutachter vorgenommen, im vorliegenden Fall von Dr. Unbehau aus Berlin, der auch für weitere Gemeinden im Saarland tätig war und ist.
Ein unabhängiger Gutachter ist sinnvoll und sogar erforderlich, weil es in Sanierungsgebieten um den sanierungsbedingten Bodenwertzuwachs geht. Da dieser Ausgleichsbetrag bis zu mehrere Tausend Euro pro Eigentümer betragen kann, braucht es eine rechtlich belastbare, nachvollziehbare Bewertung, um:
- Willkür→ zu vermeiden,
- Gleichbehandlung→ zu sichern,
- und→ gerichtsfest argumentieren zu können, falls ein Eigentümer den Bescheid anficht.
Nur ein unabhängiger Gutachter (z. B. öffentlich bestellter Sachverständiger oder z.B. der Gutachterausschuss des Landkreises) erfüllt diese Anforderung.
Spielt es eine Rolle, ob das Grundstück bebaut oder unbebaut ist?
Bei der Berechnung der sanierungsbedingten Bodenwertsteigerung (§ 154 BauGB) gilt ausdrücklich: Maßgeblich ist der Bodenwert des unbebauten Grundstücks, sowohl vor als auch nach der Sanierung.
Das bedeutet:
- Die→ Bebauung spielt keine direkte Rolle bei der Ermittlung der Wertsteigerung.
- Es→ wird fiktiv unterstellt, das Grundstück sei unbebaut.
- Nur→ indirekt kann die Bebauung eine Rolle spielen, wenn sie z. B. die Nutzung oder Erschließung beeinflusst (z. B. denkmalgeschützte Gebäude, Altlasten unter Fundamenten etc.).
Letztlich ist genau diese Fiktion sinnvoll, denn Gebäude unterliegen technischem und wirtschaftlichem Verschleiß, Böden dagegen nicht. Der Bodenwert zeigt somit die dauerhafte Marktattraktivität des Standorts. Damit lassen sich Wertsteigerungen durch städtebauliche Maßnahmen objektiv messen – unabhängig vom Zustand einzelner Gebäude.
Warum entspricht der Bodenwert aus dem Anhörungsschreiben unter Umständen nicht dem Bodenrichtwert?
Hier ist eine Unterscheidung wichtig und zwingend. Der Bodenrichtwert ist kein Verkehrswert, sondern ein durchschnittlicher Orientierungswert. Das veranschaulicht die nachfolgende Tabelle:
| Merkmal | Bodenrichtwert | Bodenwert im Gutachten |
| Grundlage | Durchschnitt aus Kaufpreisen ähnlicher Grundstücke im Gebiet | Konkretes Grundstück |
| Zweck | Orientierung, Vergleich | Verkehrswertermittlung (§§ 192–199 BauGB, ImmoWertV) |
| Einflussfaktoren | mittlere Lage, durchschnittliche Erschließung, typische Grundstücksgröße | individuelle Lage, Zuschnitt, Bebauung, Planungsrecht, Altlasten, Nutzungseinschränkungen |
Darum kann der im Gutachten ermittelte Bodenwert (und damit auch die Bodenwertsteigerung) höher oder niedriger sein als der pauschale Bodenrichtwert. Kurz gesagt: Bodenrichtwerte sind Durchschnittswerte, Gutachten sind Individualbewertungen.
Was bedeutet bei der Abrechnung die 40-Meter-Grenze?
Diese stammt aus der Bodenrichtwertermittlung und dient zur Zuordnung von Grundstücken zu einem Bodenrichtwertgebiet, wenn sie an mehreren Gebieten angrenzen. Sie wird bei der Ermittlung der Bodenwertsteigerungen analog verwendet.
Nach den Richtlinien der Gutachterausschüsse (insb. den „Hinweisen zur Bodenrichtwertermittlung“ des Oberen Gutachterausschusses) sind Grundstücksflächen, die bis zu 40 Meter tief entlang einer Straße liegen, in der Regel dem Bodenrichtwertgebiet dieser Straße zugeordnet.
Das heißt konkret:
- Der→ Bodenrichtwert gilt meist für Grundstücksstreifen bis 40 m Tiefe entlang einer Straße.
- Dahinterliegende→ Flächen (z. B. rückwärtige Hofbereiche oder Gärten) können – je nach Nutzung – einen anderen, meist niedrigeren Wert haben.
Diese Regel dient dazu, realistische Durchschnittswerte für die tatsächlich nutzbare Baufläche zu ermitteln.
Was ist ein Sanierungsvermerk?
Dass eine Abrechnung erfolgen darf bzw. muss, ergibt sich unter anderem auch aus dem Grundbuch. Denn während der Dauer eines förmlichen Sanierungsverfahrens wird bei allen betroffenen Grundstücken ein Sanierungsvermerk in das Grundbuch eingetragen (§ 143 Abs. 2 BauGB). Der Sanierungsvermerk in Abteilung II des Grundbuchs bleibt solange bestehen, bis die Sanierung offiziell beendet. Er wird also auch an Käufer von Grundstücken bzw. Häusern in diesem Gebiet übertragen, weil dies in notariellen Kaufverträgen häufig so geregelt ist. Erst nach dem Abschluss und der formellen Aufhebung des Sanierungsgebiets wird der Vermerk im Grundbuch wieder gelöscht – dann bestehen keine sanierungsrechtlichen Beschränkungen mehr.
Warum darf noch abgerechnet werden, wenn das Sanierungsgebiet durch Satzung bereits aufgehoben wurde und der Vermerk bereits gelöscht ist?
Wenn eine Sanierung als abgeschlossen gilt, hebt die Gemeinde die Sanierungssatzung durch Aufhebungssatzung auf. Damit ist das Gebiet formell kein Sanierungsgebiet mehr und auch der Sanierungsvermerk im Grundbuch wird gelöscht (§ 162 Abs. 2 BauGB).
Aber: Das heißt nicht, dass die Abrechnung damit erledigt ist.
Der entscheidende Punkt ist: Die Verpflichtung zur Zahlung des Ausgleichsbetrags entsteht mit Abschluss der Sanierung – also mit Eintritt der sanierungsbedingten Bodenwertsteigerung –, nicht erst durch die Satzung selbst. Die Aufhebung der Satzung beendet also nur das Sanierungsverfahren,
aber nicht den Anspruch der Gemeinde, die bereits entstandene Bodenwertsteigerung nachträglich abzurechnen.
Man sagt daher: Die Rechtswirkung der Sanierung endet mit der Aufhebung, die finanzielle Abwicklung (Abrechnung, Erhebung der Ausgleichsbeträge) kann danach erfolgen. Das darf bzw. muss eine Gemeinde, weil der Anspruch bereits vor der Aufhebung entstanden ist und die Aufhebung keine Rückwirkung auf diesen Anspruch hat. Das ist auch durch ständige Rechtsprechung bestätigt.
An welchen Eigentümer bzw. welche Eigentümerin richtet sich der Bescheid?
Die Ausgleichsbetragspflicht entsteht mit der Aufhebung der Sanierungssatzung, also mit dem Beschluss über die Aufhebung (§ 162 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Das folgt auch aus der ständigen Rechtsprechung (BVerwG, Urteil vom 25.01.1996 – 8 C 18.94), wonach die Beitragspflicht mit der Aufhebung der Sanierungssatzung entsteht; beitragspflichtig ist demnach derjenige, der zu diesem Zeitpunkt Eigentümer ist.
In vielen Notarverträgen im Rahmen von Grundstückskäufen wurde aber vereinbart, dass mit dem Eigentümerwechsel der neue Eigentümer die Belastungen des Grundbuchs (siehe oben) übernimmt und auch die zu einem späteren Zeitpunkt erfolgenden Kosten einer möglichen Abrechnung zu tragen hat.
Sie sollten also unbedingt Ihren Kaufvertrag dahingehend prüfen. Sollten Sie irrtümlicherweise ein Anhörungsschreiben erhalten haben, obwohl in Ihrem Kaufvertrag anderweitige Regelungen getroffen wurden, können Sie uns dies entsprechend mitteilen.
Hätte die Gemeinde andere Möglichkeiten gehabt, als die Gebiete abzurechnen?
In den vorliegenden Fällen nicht. Grundsätzlich gilt: Nicht in jedem Sanierungsgebiet führen die Maßnahmen zu einer spürbaren Bodenwertsteigerung. Wenn der sanierungsbedingte Mehrwert für die Grundstücke gering oder kaum nachweisbar ist, kann die Gemeinde nach Abstimmung mit den Fördermittelgebern (also dem Land oder Bund) entscheiden, keine individuelle Abrechnung vorzunehmen. Man spricht dann von einem Abschluss nach der sogenannten „Bagatellgrenze“.
Diese Regelung soll verhindern, dass der Verwaltungsaufwand einer detaillierten Wertermittlung und Beitragsfestsetzung in keinem angemessenen Verhältnis zum finanziellen Ergebnis steht.
Nach Bewertung durch den zuständigen Gutachter, Herrn Dr. Unbehau, Berlin, liegen in den Sanierungsgebieten Hasborn-Dautweiler und Tholey keine sog. Bagatellfälle vor. Aus seiner Sicht ist damit die Erhebung sanierungsrechtlicher Ausgleichsbeträge gemäß § 154 BauGB grundsätzlich erforderlich, da den Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern erhebliche sanierungsbedingte Bodenwertsteigerungen entstanden seien. Die Gemeinde Tholey hat hier bis zuletzt versucht, anderweitig zu argumentieren.
Wie versucht die Gemeinde derzeit, die finale Abrechnung noch zu verhindern?
Es bestehen weiterhin (verfassungs-)rechtliche Unsicherheiten hinsichtlich der tatsächlichen Erhebung der Sanierungsbeiträge. Darüber hinaus sind vor dem Bundesverfassungsgericht mehrere Verfahren zur Abrechnung solcher Gebiete anhängig. Da es aus Sicht der Gemeindeverwaltung sowie aus Sicht des Rechtsbeistandes also juristisch zweifelhaft erscheint, ob und in welcher Höhe die Ausgleichsbeträge förderrechtlich bzw. beitragsrechtlich berücksichtigungsfähig sind, soll nach Erhalt der offiziellen Bescheide des zuständigen Ministeriums zur formellen Abrechnung der Sanierungsgebiete zwischen Land und Kommune der Klageweg bestritten werden.
Was hat der Rechtsweg der Gemeinde gegen das Land mit der Abrechnung zu tun?
Wenn eine Gemeinde ein Sanierungsgebiet ausweist, erhält sie i. d. R. Zuschüsse aus der sogenannten Städtebauförderung (von Bund und Land). Diese Mittel dienen zur Deckung der städtebaulichen Aufwendungen, also z. B. Grunderwerb, Erschließung, Abbruchkosten, Modernisierungen, Freianlagen, Planungskosten usw. Der Bund bzw. das Land fördern aber nur den Teil der Kosten,
der nicht auf Private umgelegt werden kann.
Und hier liegt der entscheidende Punkt: Die Fördermittelgeber (Bund/Land) erwarten, dass die Gemeinde alle Ausgleichsbeträge ordnungsgemäß erhebt, bevor die endgültige Abrechnung der Städtebauförderung erfolgt.
Denn die Förderung ist nachrangig, zuerst müssen alle „eigenen Finanzierungsquellen“ (inkl. Der Ausgleichsbeträge) ausgeschöpft werden. Wenn die Gemeinde also weniger oder keine Ausgleichsbeträge erhebt, muss sie gegenüber dem Fördermittelgeber die gewährten Fördermittel zurückzahlen.
Warum werden dann trotzdem Anhörungen und später Bescheide verschickt?
Eine Erhebung gegenüber den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern muss dennoch erfolgen. Denn ungeachtet der derzeit noch bestehenden verfassungsrechtlichen Unsicherheiten hinsichtlich der landesrechtlichen Regelungen zur Erhebung von Ausgleichsbeträgen gemäß § 154 BauGB ist die Gemeinde zur Durchführung des beitragsrechtlichen Verfahrens bis zum 31. Dezember 2025 verpflichtet. Eine Verjährung würde zum 31. Dezember 2025 eintreten, deren Inkaufnahme wiederum haftungsrechtliche Fragestellungen für die Gemeinde Tholey, die Beschäftigten und den Bürgermeister zur Folge hätte. Dies reicht bis hin zu strafrechtlichen Fragestellungen der Haushaltsuntreue.
Warum wurden die Bescheide nicht früher verschickt?
Weil die Gemeinde bis zuletzt versucht hat, gemeinsam mit ihrem Rechtsbeistand das Erfordernis einer Abrechnung zu vermeiden, indem gegenüber dem Land die potentielle Anwendung einer Bagatellregelung sowie weitere juristische Aspekte angebracht wurden.
Andreas Maldener bietet allen Interessierten an, das von Dr. Unbehau erarbeitete Gutachten im Rathaus in Tholey jederzeit anschauen zu können. „Es ist mir wichtig, dass wir eine gemeinsame Lösung finden und wir werden alles mit den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten versuchen, den Bürgerinnen und Bürgern in dieser Angelegenheit zu helfen“, so der Bürgermeister abschließend.